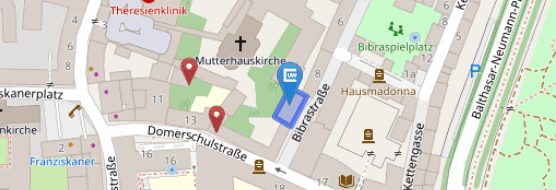KI in der Theologie? – KI in der Theologie! Fortbildungstag zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz
12.05.2025Am 10. April 2025 bildete sich die Katholisch-Theologische Fakultät einen Tag lang zum Thema Künstliche Intelligenz fort. Nach Einblicken in die KI-Forschung, die es bereits an der Fakultät gibt, war der Tag verschiedenen Anwendungsfeldern gewidmet.
Künstliche Intelligenz prägt das Studium, das Arbeitsleben und auch das Alltagsleben zunehmend. Grund genug, sich mit den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, der Bedeutung, aber auch den Herausforderungen an einer Katholisch-Theologischen Fakultät auseinanderzusetzen. Die Organisatoren Frau Dr. Agnes Slunitschek und Herr Prof. Dr. Johannes Heger hatten dafür bewusst das Format eines Fortbildungstags für die ganze Fakultät gewählt: „KI betrifft alle Fakultätsmitglieder in ihren verschiedenen Tätigkeiten, darum wollten wir ein Angebot machen, bei dem für alle etwas dabei ist. Der Tag bot zudem die Chance, die Gemeinschaft der Fakultät über die Statusgruppen hinweg zu stärken.“, so die beiden.
Der Tag begann mit zwei theologischen Kurzvorträgen, die Schlaglichter auf spezifisch theologische Fragen zu KI warfen. Prof. Dr. Wolfgang Schröder gab im Auftaktvortrag „Digitalität, KI, Universität und Ethik!? – Sondierungen in einem komplexen Feld“ einen Überblick über die Reichweite der Digitalisierung, markierte Herausforderungen und zeigte mögliche ethische Bewertungsansätze auf. Sein Fazit war mit Luciano Floridi: „The digital age is the age of design. It should be the age of good design.“
Schröder hatte schon auf den Unterschied von Daten und Wissen und die fortschreitende Digitalisierung der Hochschulen hingewiesen, was Prof. Dr. Johannes Heger in seinem Vortrag zu „KI im Kontext der (Hoch-)Schule – Ausgangspunkte, Herausforderungen und Ausrichtungen“ weiter vertiefte. Er appellierte an die Lehrenden, die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit KI wahr- und ernst zu nehmen; nicht zuletzt, weil heutige Schüler:innen und Studierende die technischen Möglichkeiten bereits selbstverständlich nutzen. Das erfordere, „Bildung und Wissenschaft neu zu denken“. Zugleich gelte es, die mit KI verbundenen Herausforderungen wahrzunehmen und zu einer reflektieren Haltung dazu zu kommen.
Nach diesen Perspektiven auf KI als theologischem Forschungsgegenstand war das weitere Programm praktisch ausgerichtet. Dr. Michael Winklmann (Hochschuldidaktik KU Eichstätt) demonstrierte verschiedene KI-Tools für das (Theologie-)Studium und brachte Vorschläge mit, wie in KI-Zeiten anders gelehrt werden kann, so dass KI-Tools das Denken und Lernen nicht ersetzen, sondern entlasten, unterstützen und erweitern. Dass das im Hochschulalltag auch Regeln erfordert, wurde ebenfalls deutlich.
Besonders beeindruckt zeigten sich Studierende und Dozierende von den Potenzialen von Notebook LM: Überrascht, irritiert und letztlich fasziniert lauschten die Teilnehmer:innen bspw. einem durch das Programm erstellten Podcast, der auf der Grundlage von Publikationen Johannes Hegers erstellt wurde. Dass dies Effekte auf die Lektürebereitschaft von Studierenden und ihr Rezeptionsverhalten hat, wurde ebenso deutlich wie die Chance, solche Tools in der Lehre einzusetzen.
Am Nachmittag gab es den verschiedenen Arbeitsfeldern an der Fakultät entsprechend zwei Workshopangebote zur Wahl: Bei Dr. Thorsten Aichele (ProfiLehre Uni Würzburg) und Dr. Petra Zaus (Schreibzentrum Uni Würzburg) ging es um „Einsatzmöglichkeiten von KI als Unterstützung bei Schreib- und Lernprozessen sowie in der Lehrplanung“ und bei Dr. Michael Winklmann um „Siri & Co. im Büro – KI-Assistenten in Forschung und Verwaltung“.
Die Expert:innen aus Würzburg, die am Nachmittag zur Veranstaltung hinzustießen, ordneten die Möglichkeiten der KI-Assistenz sowohl (hochschl-)didaktisch bzw. schreibdidaktisch metatheoretisch ein. Ein Teilnehmer formulierte passend dazu: „Erst heute wurde mir deutlich, dass KI-Assistenz auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann.“ An konkreten Beispielen wurde aber auch bei dieser Vertiefung klar, was bereits am Vormittag als common sense im Raum stand: Die Möglichkeiten gilt es auszuschöpfen; zugleich gilt es aber auch den Rahmen hierzu zu reflektieren.
Zwei wichtige Hinweise dazu gab Dr. Michael Winklmann in seinem Workshop. Ihm zu Folge müsse es sich „in der Hochschullehre wieder stärker durchsetzen, den Lernweg transparent zu machen. Das ist wie beim Ausschreiben des Rechenwegs in der Schule: Es zeigt nicht nur ein Ergebnis, sondern macht sichtbar, wie es zustande kommt!“ Und generell gelte: „Wenn wir gemeinsam in Seminaren Regeln erarbeiten, wie wir mit KI umgehen wollen, dann gibt es bei den meisten Studierenden eine hohe Motivation, sich daran zu halten.“
Mit dem Fortbildungstag wurde der „KI-Frühling“ an der Fakultät eingeleitet. Die teilnehmenden Professor:innen, Sekretärinnen, wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen und Studierenden waren sich einig: Aus dem Fragezeichen aus dem Titel „KI in der Theologie?“ war am Ende des Tages ein klares Ausrufezeichen geworden. Es war ein sehr gelungener Tag, der aber nur einen Auftakt darstellen kann; die Fakultät muss und will weiter am Thema dranbleiben.