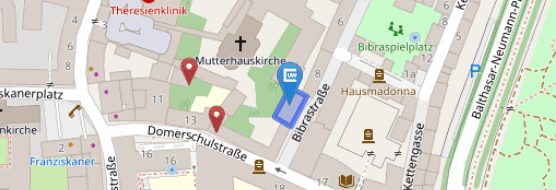Aktuelles

Zum Wintersemester 2025/26 übernimmt Prof. Dr. Markus Lau den Lehrstuhl für neutestamentliche Exegese.
Zum Tod von Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Josef Klauck
Nachruf der Katholisch-Theologischen Fakultät

Die Katholisch-Theologische Fakultät
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
trauert um
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Josef Klauck OFM
geboren am 4. Juni 1946
gestorben am 27. März 2025
Hans-Josef Klauck wurde am 4. Juni 1946 in Hermeskeil bei Trier geboren. Nach dem Abitur trat er am 21. April 1966 in den Franziskanerorden ein und studierte Philosophie und Theologie in Münster und Bonn. Am 15. Juli 1972 empfing er in Münster die Priesterweihe. Nach kurzer Tätigkeit in der Seelsorge im Münsterland und einem Spezialstudium in Bibelwissenschaft und Judaistik in Münster war er ab 1975 als Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Neues Testament an der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig. Aufgrund der Dissertationsschrift „Allegorie und Allegorese in synoptischen Gleichnistexten“ wurde er 1977 zum Doktor der Theologie promoviert. Bereits zwei Jahre später erfolgte aufgrund der Studie „Herrenmahl und hellenistischer Kult. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum ersten Korintherbrief“ seine Habilitation.
1981 folgte Klauck zunächst dem Ruf auf den Lehrstuhl für Neues Testament und neutestamentliche Zeitgeschichte der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1982 sodann dem Ruf auf den Lehrstuhl für Neutestamentliche Exegese der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und 1997 schließlich dem Ruf auf den Lehrstuhl für Neutestamentliche Exegese und Biblische Hermeneutik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 1999 bis 2003 war er zudem als Honorarprofessor an der University of Pretoria in Südafrika tätig. 2001 wurde er an die renommierte Divinity School der University of Chicago berufen, wo er bis 2016 die Naomi Shenstone Donnelley Professorship of New Testament and Early Christian Studies innehatte.
Gerade seine Würzburger Zeit war eine Zeit hoher Produktivität. In rascher Folge erschienen seine beiden Kommentare zu den Korintherbriefen in der Echter-Bibel (1984; 1986; bis 2004 in 3. bzw. 4. Aufl.); nur fünf bzw. sechs Jahre später vollendete er die Kommentierung der drei Johannesbriefe in der renommierten EKK-Reihe, deren Herausgeber er später wurde (neben der Biblischen Zeitschrift, der WUNT-Reihe oder der Hermeneia-Kommentarreihe in den USA). Seine breite Verortung in Religion und Kultur der Antike dokumentiert die zweibändige „Umwelt des Urchristentums“ (1995; 1996), die Übersetzungen ins Englische, Portugiesische, Französische und zuletzt Japanische (2017) erlebte und als Standardwerk gelten kann. Sein kurz nach seinem Weggang aus Würzburg erschienenes Lehrbuch „Die antike Briefliteratur und das Neue Testament“ (1998; engl. 2006; ital. 2011) setzt heute noch Maßstäbe.
Später traten die neutestamentlichen Apokryphen in das Blickfeld Klaucks, zu denen er ebenfalls breit publizierte. Genannt seien nur die ebenfalls in mehreren Auflagen erschienenen Einführungen in die apokryphen Evangelien und Apostelakten, wieder mit Übersetzungen in mehrere Sprachen. Dass er daneben noch Zeit für zahlreiche Monografien und Aufsatzbände fand, in denen er seine in die Legion gehenden Aufsätze und Lexikonartikel bündelte, überrascht nur jene, die sein strenges Zeitmanagement und seine eiserne Disziplin nicht kannten. Urlaub war für Hans-Josef Klauck eher ein Fremdwort. Wer mit ihm zu tun hatte, lernte einen absolut verlässlichen Menschen kennen, dessen Objektivität manchmal beinahe wehtat, und der den Wechselfällen des Lebens mit einer fast schon stoisch zu nennenden Gelassenheit gegenübertrat, die vorbildlich war.
In Anerkennung seiner großen Verdienste um die Erforschung der Theologie und Geschichte des Urchristentums wurde ihm 2008 von der Theologischen Fakultät der Universität Zürich die Ehrendoktorwürde verliehen.
Die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Würzburg ist Hans-Josef Klauck für seinen engagierten Einsatz in Forschung und Lehre zu großem Dank verpflichtet. Er war eine von Studierenden und Lehrenden gleichermaßen geschätzte Persönlichkeit, die stets um die Mitgestaltung des Fakultätslebens bemüht war. So engagierte er sich von 1987 bis 1997 als Bibliotheksbeauftragter und bekleidete von 1995-1997 das Amt des Dekans.
Die Katholisch-Theologische Fakultät trauert um einen geschätzten und beliebten Kollegen von internationalem Rang und wird sein Andenken in hohen Ehren halten.
Prof. Dr. Matthias Remenyi
Dekan

Nach dem Sommersemester 2024 geht Prof.em. Heininger in den Ruhestand.
Im August 2023 ist ein Sammelband für Prof. Heininger mit dem Titel „Christentum in seinen Anfängen. Kulturelle Begegnungen und theologische Antworten“ in der Reihe „Würzburger Theologie“ erschienen. Weitere Informationen sind hier zu finden.
Am 05.12.2022 ist bei Bayern 2 ein Beitrag in Theo.Logik mit dem Titel "'Was für ein Wunder'. Wunder gibt es!" erschienen, an dem Prof. Heininger mitgewirkt hat.
Die Audio-Datei ist hier abrufbar.
Nachruf
Frau Hannelore Ferner
Der Lehrstuhl für Neutestamentliche Exegese
und die Professur für Biblische Einleitung
trauern um ihre langjährige Sekretärin
Frau Hannelore Ferner,
die am 8. August 2021
nach schwerer Krankheit verstorben ist.
Leben für die Exegese. Zum Tod von Hannelore Ferner
Als Hannelore Ferner, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Biegner, am 1. Mai 1966 im zarten Alter von 18 Jahren ihren Dienst am Lehrstuhl für Neutestamentliche Exegese bei Prof. Rudolf Schnackenburg antrat, ahnte sie vermutlich noch nicht, wie sehr die Arbeit an diesem Lehrstuhl ihr zukünftiges Leben bestimmen sollte. An die Universität Würzburg war sie schon drei Jahre früher gekommen: Sie hatte ihre Ausbildung zunächst im Rektorat begonnen, wollte wegen mangelnder Eigenständigkeit und Kreativität aber bald wechseln. Als sich gut zwei Jahre später die Chance bot, in das Sekretariat eines Professors zu wechseln – die damalige Dekanatssekretärin der Kath.-Theol. Fakultät hatte ihr den entsprechenden Tipp gegeben –, packte sie diese Chance am Schopf, absolvierte das Vorstellungsgespräch mit Erfolg und war einige Monate später Lehrstuhlsekretärin.
Die ersten Jahre waren kein Zuckerschlecken. Denn Rudolf Schnackenburg, schon damals Nestor der katholischen neutestamentlichen Exegese und maßgeblich für die Etablierung der sogenannten historisch-kritischen Methode auf dem 2. Vatikanischen Konzil verantwortlich, brauchte eine Sekretärin, die (Alt-)Griechisch lesen und schreiben konnte. Täglich 15 Minuten Griechisch standen deshalb ebenso auf der Agenda wie die Frühgymnastik, die bei seiner Mitarbeiterin und seinen Mitarbeitern jedoch auf wenig Gegenliebe stieß. Hannelore Ferner bewältigte diese Herausforderung wie alle anderen Herausforderungen mit Bravour und entwickelte – zunächst an der Schreibmaschine, später am Computer – bei der Arbeit ein Tempo, das seinesgleichen suchte. Das will bei Geräten, bei denen man beim Wechsel von einer Sprache (Deutsch) in die andere (Griechisch) jedes Mal den Kugelkopf wechseln musste, etwas heißen! Weder Rudolf Schnackenburg noch sein Nachfolger Hans-Josef Klauck (ab 1982) hätten ihre Bücher und in die Hunderte gehenden Aufsätze ohne das Mitwirken von Hannelore Ferner zu Papier gebracht, jedenfalls nicht in dieser Zeit. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Dissertationen und Habilitationen, die sie „nebenbei“ noch tippte, vor allem dann, wenn es bei den zukünftigen Doktoren und Professoren wieder einmal brannte, d.h. der Abgabetermin der Arbeit unerbittlich näher rückte. Bei alledem verlor sie nie die Ruhe und hatte selbst im größten Stress noch Zeit für ein Gespräch, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen. Das änderte sich auch nicht, als Anfang der 2000er Jahre der Lehrstuhl für Biblische Einleitungswissenschaften an den Sanderring zog und sie fortan – gegen die biblische Tradition! (Mt 6,24 par Lk 16,13) – zwei Professoren zu versorgen hatte (Karlheinz Müller/Johann Rechenmacher; Bernhard Heininger).
Zu erzählen hatte Hannelore Ferner nämlich viel – kein Wunder bei einer Frau, die fast ein halbes Jahrhundert am Biblischen Institut tätig war. Sie erlebte die „wilden Jahre“ der Fakultät mit, die einen früheren Kollegen die Erzbischofswürde gekostet haben sollen (Bischof ist er dann doch noch geworden), und gerade von ihrem ersten und langjährigen Chef wusste sie so manche Anekdote zu berichten. Als Rudolf Schnackenburg einmal von einem Kongress zurückkehrte und freudestrahlend verkündete, er habe in der Schweiz ein Chalet zwecks gemeinsamen Urlaubs erworben („Kinder, da können wir jetzt Urlaub machen!“), war die Begeisterung bei Sekretärin und Assistenten nicht gerade überwältigend. Sie sind dann doch mitgefahren, aber irgendwann verlor Schnackenburg das Interesse. Als er Jahre später mit seinem Assistenten Helmut Merklein wieder einmal in die Schweiz fuhr, fanden sie das Ferienhaus nicht mehr. Es war zugewachsen. Helmut Merklein, nachmaliger Neutestamentler in Bonn und nicht nur exegetisch ein Hüne, musste mit der Machete den Weg durch das Gestrüpp bahnen.
Hannelore Ferner hat solche Situationen stets mit Humor und einem gewissen Gleichmut genommen und mit ihren lakonischen Kommentaren die gelegentlich in theologischen Wolken schwebenden Professoren schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bei den zahlreichen „Rauchopfern“ zunächst noch im Sekretariat, später auf der Veranda (nachdem das Rauchen an der Universität bzw. in öffentlichen Gebäuden verboten war) ging es häufig um Gott und die Welt und immer um das Leben in all seinen Facetten. Ihr eigenes Leben war vielleicht kein Gesamtkunstwerk (oder doch?), aber ein Narrativ, das noch lange zu uns spricht. Jedenfalls solange wir uns an sie erinnern. Am 8. August dieses Jahres ist Hannelore Ferner, kurz vor Vollendung des 74. Lebensjahres, nach schwerer Krankheit verstorben.
Bernhard Heininger