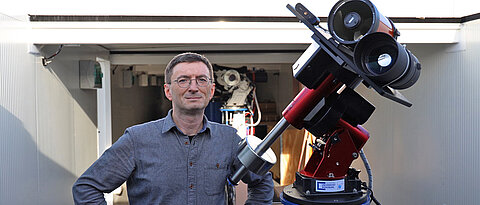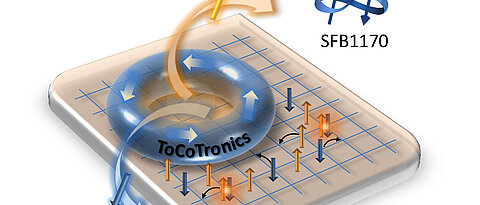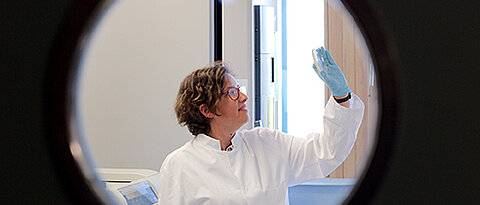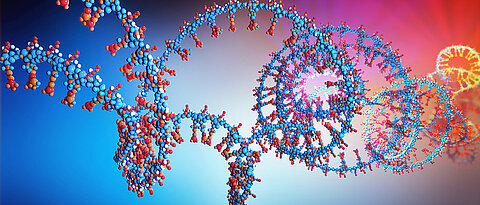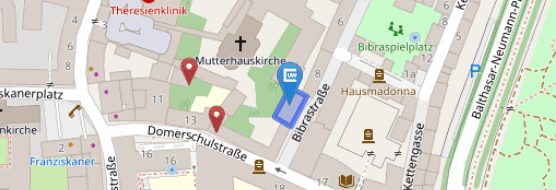Zwei Millionen Euro für die Krebsdiagnostik
06/17/2019
Die Bayerische Forschungsstiftung fördert mit zwei Millionen Euro das Projekt FORTiTher, das maßgeblich von Universität und Universitätsklinikum Würzburg gestaltet wird. Erforscht werden neue diagnostische Verfahren bei Krebs.
more