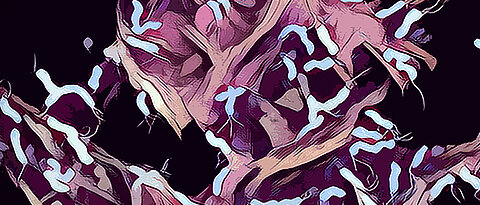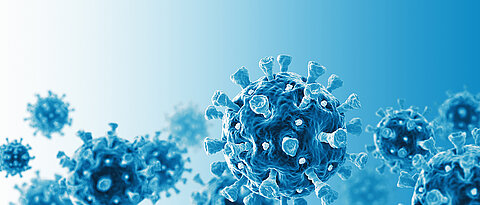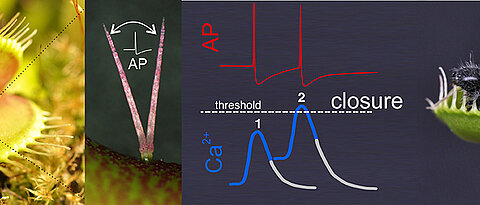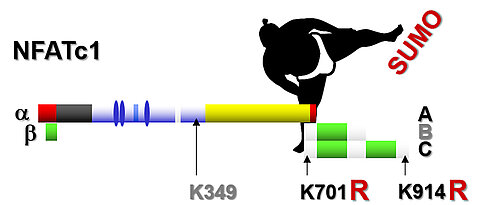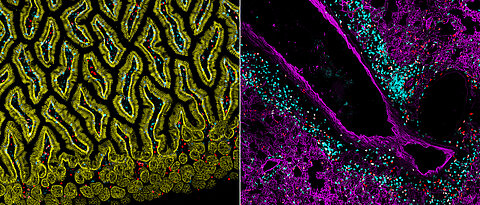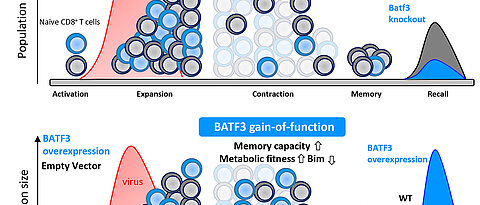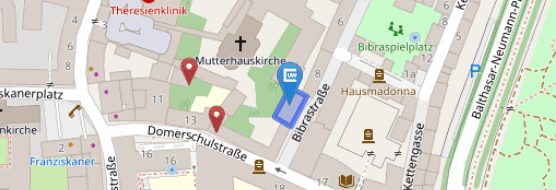Wenn die Sprachentwicklung gestört ist
10/16/2020
Heute, 16. Oktober, ist der Internationale Tag der Sprachentwicklungsstörung. Studierende der Universität Würzburg werden deshalb mit zahlreichen Aktionen auf diese weitgehend unbekannte Störung aufmerksam machen.
more